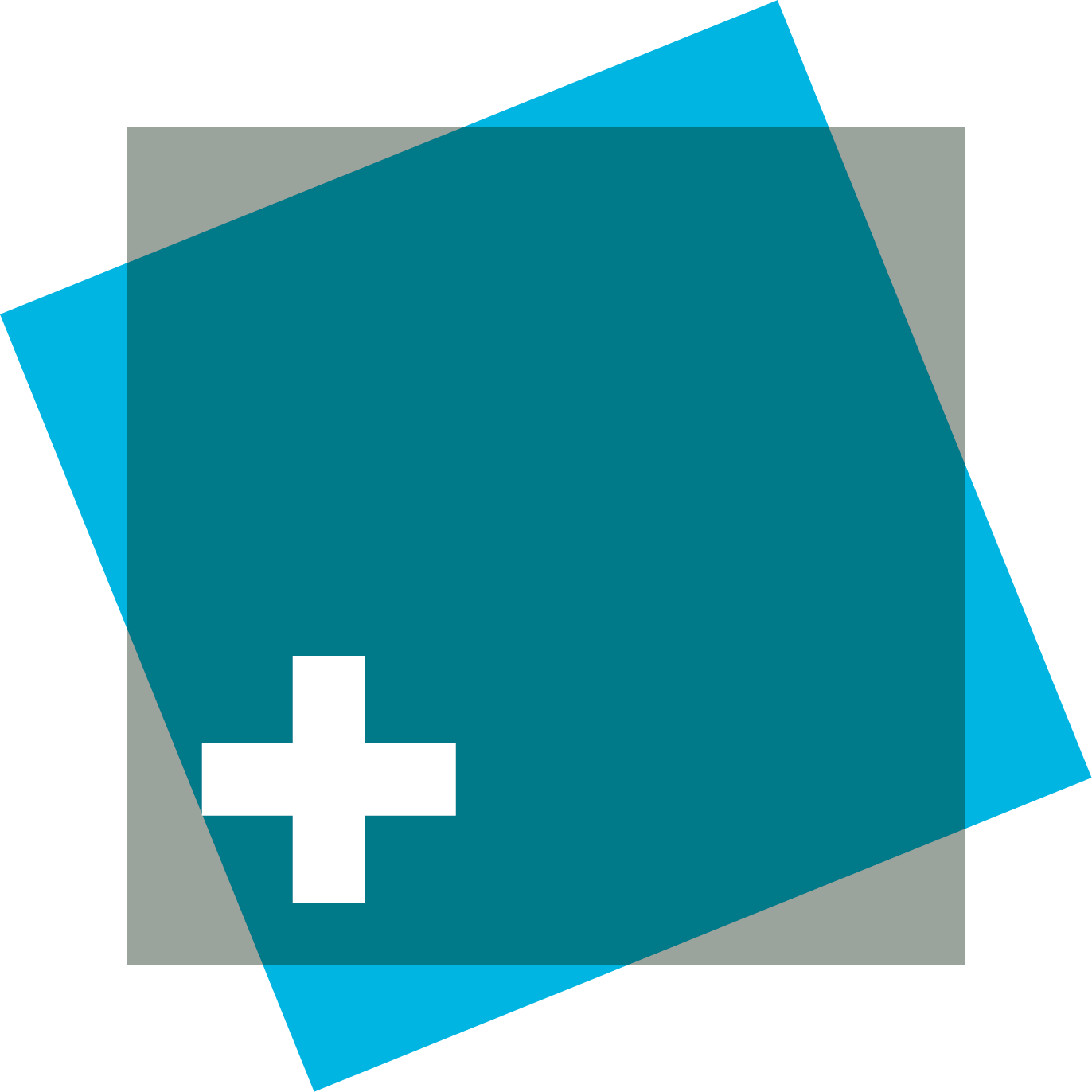Warum es auch in Zeiten von Corona gute Risiken gibt
Anne-Kathrin Bolender
Risiken sind immer schlecht, es gibt keine guten Risiken, werden die meisten spontan denken. Auch ich verbinde in der ersten Sekunde Risiko immer mit etwas Negativem – obwohl ich es als Risk Facilitator eigentlich besser weiss. Risiken zu verstehen und zu formulieren ist eine kleine Kunst und in Risk Sessions wird meist viel über ein "gutes" Risiko gestritten. Ist dies bei Ihnen nicht der Fall, ist Ihr Projektteam vermutlich zu wenig darauf sensibilisiert, wie man Risiken formuliert.
Vergewissern Sie sich, welche Risikoterminologie Ihre Projektbeteiligten verwenden
In Fachbeiträgen zum Thema Risikomanagement wird häufig die ISO 31000:2018 der International Organization for Standardization oder die Definition des Project Management Institute (PMI) zitiert (z.B. Ayala-Cruz, 2016 vs. Alhawari, Karadsheh, Nehari Talet & Mansour 2012). Sollten Sie im internationalen Kontext arbeiten, lohnt es sich zu prüfen, ob bzw. welche der beiden Organisationen in den anderen Ländern mit einem eigenen Dachverband vertreten ist, um die entsprechende Risikoterminologie entsprechend aufzugreifen und dadurch die Akzeptanz zu erhöhen (z.B. ISO, n.d. und PMI, 2020).
Stellen Sie sicher, dass alle dasselbe Risikoverständnis haben
Ein Risiko hat immer eine oder mehrere Ursachen und eine oder mehrere Konsequenzen. In Risk Sessions werden Risiken entweder zu ungenau formuliert oder es werden zu viele Ursachen oder Konsequenten in einem Risiko zusammengefasst. Dies macht es schwer, entsprechende Massnahmen zu definieren und an der Senkung des Risikos zu arbeiten. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Risiko negativ behaftet – doch damit wird dem Risiko Unrecht getan. Die ISO definiert Risiko als ein “effect of uncertainty on objectives” (ISO, 2018). Dieser “Effekt” (auch übersetzbar mit Wirkkraft) ist eine Abweichung vom Erwarteten und ist eine neutrale Formulierung, die nichts darüber aussagt, ob diese Unsicherheit sich positiv oder negativ auswirkt. Deshalb kann ein Risiko zu einer Chance oder einer Gefahr werden.
Um ein Risiko zu formulieren, muss erst einmal eine Ursache identifiziert werden, die ein Ereignis auslöst, was dann eine positive oder negative Konsequenz nach sich zieht. Zur Risikobewertung wird die Wahrscheinlichkeit diskutiert, mit der diese Chance oder Gefahr eintritt. Das PMI verdeutlicht die Unsicherheit bereits in seiner Definition: “an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on a project's objectives” (PMI, 2013, cited in Hillson, 2014).
Wie Sie gute Risiken formulieren
Um in Risk Sessions gute Risiken zu formulieren, sollten Sie immer ein paar ausgedruckte Formulare dabeihaben, die eine Risikoformulierung festschreibt. In Covid-Zeiten lohnt es sich, eine Folie einzublenden oder vorab (jedes Mal) eine Mail zu schicken, welche ausschliesslich die Risikoformulierung enthält. Diese Formulierung dient Ihren Kolleg/innen als Gedächtnisstütze und kann schnell zu Rate gezogen werden, um ein "gutes Risiko" zu formulieren. Das erspart mühevolles Suchen im Postfach und ist ein kleiner Service Ihrerseits. Packen Sie keine weiteren Infos in diese Mail, so dass es hinterher einfach gelöscht werden kann:
If [an uncertain event] occurs due to [a specific cause], …
… then it has a [positive/negative consequence] on a [project’s objective].
Die von mir vorgeschlagene Risikoformulierung enthält analog obengenannter Definition vier Teile: Das unsichere Ereignis, welches aufgrund einer Ursache eintreten kann, die daraus folgende Chance oder Gefahr, welche wiederum ein Projektziel beeinflusst.


Warum ein so hoher Detaillierungsgrad?
Gern werden Ursachen oder Konsequenzen zusammengefasst ("damit’s schneller geht"), nur Gefahren erfasst ("ein Risiko ist eh immer negativ") und Projektziele vernachlässigt ("ist doch ein Risiko fürs Projekt, ich weiss das, warum also noch mal extra erwähnen?"). Doch genau diese Detaillierung unterstützt die Klärung, was genau passieren muss, damit ein Risiko eintritt und zu einem Ereignis wird. Es können durchaus mehrere Ursachen eine Konsequenz haben, doch muss klar sein: Müssen alle Ursachen gleichzeitig eintreten oder reicht eine schon aus? Und gibt es nur eine Konsequenz? Und vor allem, welches Projektziel ist betroffen? Zum einen ist dies eine wichtige Information für ein Steering Board, zum anderen hilft es auch bei der Erarbeitung von Massnahmen.
Bei sehr allgemeinen Risikoformulierungen handelt es sich in der Regel eher um Bedenken, spontan fallen Ihnen bestimmt ein, zwei Bedenkenträger/innen ein. Bei guten Risikoformulierungen fallen diese Bedenken dadurch auf, dass sie sehr generischer Natur sind und meist nicht projektspezifisch sind.
Nun können Sie loslegen und gute Risiken formulieren. Bleiben Sie gesund!
Quellen und weiterführende Informationen
Alhawari, S., Karadsheh, L., Nehari Talet, A., & Mansour, E. (2012). Knowledge-based risk management framework for information technology project. International Journal of Information Management, 32(1), 50-65.
Ayala-Cruz, J. (2016). Project risk planning in high-tech new product development. Academia Revista Latinoamericana De Administración, 29(2), 110-124.
International Organization for Standardization (ISO) (2018). ISO 31000:2018(en) Risk Management – Guidelines.
ISO (2009). ISO/Guide 73:2009(en) Risk management – Vocabulary.
Kayis, B., Zhou, M., Savci, S., Khoo, Y.B., Ahmed, A., Kusumo, R., & Rispler, A. (2007). IRMAS - development of a risk management tool for collaborative multi-site, multi-partner new product development projects. Journal of Manufacturing Technology Management, 18(4), 387-414.
Müller, R., & Turner, R. (2007). The influence of project managers on project success criteria and project success by type of project. European Management Journal, 25(4), 298-309. doi: 10.1016/j.emj.2007.06.003.
Diese Seite teilen
CAS FH in Projektmanagement
Certificate of Advanced Studies (CAS)

Risikomanagement mit Herz oder Verstand?
Risikomanagement – sinnvolle Aufgabe oder lästige Pflicht?